| Zurück |
Impressum
Datenschutz
Das Geheimnis der Meseta
Nahezu
tropisch warme Sonne übergoldet das leicht bewegte Wasser
einer Bucht, die der Ferne zu in ein Binnenmeer ausmünden
könnte. Mag schon die Wasserweite ein Meer vortäuschen
- in Wirklichkeit ist es doch nur ein See, der hier im Andenhochland
seine blauen Wasser spielen läßt. Noch ist bei diesem
größten Hochlandsee unseres Planeten, dem Titikaka von rund
200 km Länge und rund 180 km Breite, urwüchsiges
Indianerleben anzutreffen, wie es das äußerst dünn
besiedelte Bolivien vielfach vorweist. Armut und beispiellose
Anspruchslosigkeit lösen beim kulturverwöhnten Besucher
dieser Gegend zwiespältige Gefühle aus, sobald er eben noch
in einem der wenigen Zentren mit Großstadtluft verweilte,
gleichsam einer kulturell betonten Oase inmitten meilenweiter
Naturstille und Hochlandeinsamkeit. Wo auf einen Quadratkilometer
Fläche im Mittel nur drei Menschen leben, kann das nicht anders
sein.
Neben kleineren Gewässern
flutet der Titikaka auf jener
gewaltigen, heute rund 4000 m über dem Meeresspiegel liegenden
Hochlandfläche zwischen der östlichen Haupt- und der
westlichen Küstenkordillere. Das von den Eingeborenen mit
Meseta benannte Hochland ist etwa 200 km breit, besitzt eine
Längenausdehnung von weit über 1000 km und fällt
(zwischen dem 15. bis 25. Breitengrad) in geringem Maße von
Norden nach Süden zu ab. Im Norden ist die Meseta durch die
kreuzende Kordillere (Cordillera Crucera) gegen das in die
Amazonasniederung verlaufende Hochland von Peru abgeriegelt. Im
Süden dagegen endet die Meseta allenthalben unvermittelt mit den
chilenischen Salpeterfeldern an der zum Stillen Ozean steil abfallenden
Küste. Soweit unser Hochland bergig erscheint, erreichen die
Höhen nicht entfernt diejenigen der sie umschließenden
Gebirgsketten, deren schneebedeckten Gipfel das Hochland im Mittel
einige Hundert, zum Teil bis zu anderthalbtausend Meter überragen.
Voller Erwartung ist der
Forschungsreisende hierher geeilt, der glaubt,
sich am heutigen Natur- und Landschaftsbild davon überzeugen zu
können, daß ein Mondkataklysmus zumal hier seine sichtbaren
Spuren hinterlassen hat und vor allem die zunächst befremdende
These an Beweiskraft gewinnt, daß nicht nur primitive, sondern
gleichwohl mit Weisheit gesegnete Menschen der Jahrmillionenferne die
Tragödien tatsächlich durchlebt bzw. bis auf Restteile
überstanden haben. Solange man allerdings das Bild der
Urindianer noch vor Augen hat, die auf verschilften Filzdecken in
Buchten des Titikaka ein mehr als dürftig zu nennendes Dasein
bestreiten, möchte man kaum glauben, daß an gleicher Stelle
und auch außerhalb des Hochlandsees dereinst hohe Kulturen
niedergebrochen sind. Doch jeder Zweifel an deren einstigem
Bestehen schwindet, sobald man das unweit vom Titikaka sich
erstreckende Ruinenfeld von Tihuanaku betritt. Noch hat der Zahn
der Zeit die teilweise freigelegten Bauwerke der Vorferne nicht derart
zermalmt, hat menschlicher Unverstand nicht soviel hinweggeräumt,
daß eine Rekonstruktion vergeblich bleibt. Ist doch ein
nicht geringer Teil der hier ruhenden Bauwerksreste ausgeraubt und
für neuzeitliche Bauvorhaben verwendet worden, lange bevor sich
Gelehrte der modernen Altertums- und Vorgeschichtsforschung damit
beschäftigten.
Ob man die Kirche des heutigen
Landstädtchens Tihuanaku in
Augenschein nimmt, seltsame Kapitelle an den Gutshäusern der
Finkeros bewundert, ob man eine gepflasterte Straße oder eine
steinerne Brücke überwandert - alsbald wird man gewahr,
daß die hierfür verwendeten Werksteine, Skulpturen, Portale,
Fenstereinfassungen, Wasserleitungsrinnen und dergleichen mehr fast
ausnahmslos dem nahegelegenen Ruinenfeld entnommen sind. Mit
einigem Stolz weist ein indianischer Bauer auf die Eingangstür
seiner sonst dürftigen Behausung hin. Die Tür ist
wohlverstanden aus skulptierten Werksteinen aufgebaut, die zum Teil
gerade dem wertvollsten vorzeitlichen Nachlaß Urtihuanakus
entrissen wurden. Und wenn wir die Mulas des Indios aus einem
prächtig gearbeiteten Trog mit eingemeißelten Treppenfiguren
und großen Spiralbändern fressen sehen, so dürfte der
Hausherr keine blasse Ahnung davon haben, welche Kostbarkeit einer fern
gelebten Zeit hier einer grauen Alltäglichkeit geopfert
wurde. Es mag dem Massengewicht der in Vorzeiten verwendeten
Steinblöcke zu verdanken sein, daß wesentliche Bauwerke
nicht allzusehr verstümmelt wurden und einem baukundigem und
architektonisch geschultem Fachmann die Möglichkeit bieten, sie im
Geiste wiederherzustellen.
Seit geraumer Zeit hat nun ein
besonderes Bauwerk des Ruinenfeldes ein
unabänderlich hohes Interesse bei noch allen hier grabenden und
schürfenden Gelehrten erweckt. Die schweren Riesenpfeiler
der einstigen Umfassungsmauern des ersichtlich kultischen und
gestirnskundlichen Zwecken dienenden Baues, das Ostportal mit seiner
monumentalen Freitreppe, ferner einige Steine im Innern der Anlage und
solche, die unter Schutt lagen, lassen zum mindesten den Grundriß
der Anlage bis auf den Zentimeter genau erkennen. Für eine
hier ausgeübte und zur praktischen Anwendung gelangenden
Gestirnsbeobachtung spricht vor allem ein
verhältnismäßig nur wenig beschädigtes,
vorläufig mit "Sonnentor" benanntes Baugebilde. Es besteht
aus einem Block graugrüner Andesitlava von etwa zehn Tonnen
Gewicht mit einer herausgemeißelten Türöffnung von
Manneshöhe. Über der Türöffnung zieht ein
eigenartiger Figurenfries entlang, der die gelehrten Deuter von
Anbeginn an auf ein in Stein verewigtes Kalendersystem schließen
ließ.

(Bildquelle/-text: Buch "Das Sonnentor von
Tihuanaku und Hörbigers Welteislehre" von E. Kiss, 1937)
Lichtbild des Sonnentores in Tihuanaku. Phot. Professor Arthur Posnansky in La Paz
Lichtbild des Sonnentores in Tihuanaku. Phot. Professor Arthur Posnansky in La Paz
Dieser Schluß ist sehr
naheliegend, denn ohne einen Kalender als
zeitbestimmendes Verständigungsmittel bleibt jede Kultur, auch die
unserige, in Frage gestellt. Seit es Menschen verstanden,
über den primitiven Zeitbegriff von Tag und Nacht
hinauszugelangen, d.h. dem jährlichen Gang der Sonne auf die Spur
zu kommen und vor allem den rhythmischen Wechsel der Mondphasen zu
erkennen und mit der periodischen Wiederkehr bestimmter
Naturabläufe (Jahreszeitenwechsel, Wachstumsperioden usw.) in
Beziehung zu setzen, war eine Grundlage für eine
kalendermäßige Zeiteinteilung und damit eine
Kulturentwicklung schlechthin gewonnen. Denn kulturlos wären
wir allesamt geblieben, hätten es gestirnskundige Praktiker nicht
schon vor langen Jahrtausenden verstanden, erkannte
Gesetzmäßigkeiten im Gang der Gestirne zeitbestimmend
auszuwerten, dem Wirtschaftsleben nutzbar zu machen und damit wertvolle
Vorarbeit für alle spätere astronomische Rechenarbeit zu
leisten! Dieser wiederum verdanken wir es, daß wir heute
über ein wohlgeordnetes Zeitsystem verfügen, beispielsweise
unser Gregorianischer Kalender bis auf einen geringfügigen Fehler
von noch nicht 24 Stunden in dreieinhalb Jahrtausenden mit dem
kosmischen Uhrwerk übereinstimmen soll.
Seit Alexander von Humboldt an
der Wand der Kathedrale von Mexiko einen
Kalenderstein der alten Azteken bewunderte, der auf eine
Jahreseinteilung von
18 Monaten (!) schließen läßt, hat sich das Material über offenbar uralte Kalendersysteme fast unwahrscheinlich gehäuft. Die Struktur eines alten Mayakalenders läßt beispielsweise erkennen, daß er nicht nur Jahrtausende hindurch bis zum Einfall der Spanier befriedigend funktionieren konnte, sondern in mancher Hinsicht unserem heutigen Kalender noch überlegen war.
Bis in die Neuzeit hinein galt es für ausgemacht, daß ältester Kalenderbrauch in den alten Kulturzentren der Euphrat- und Tigrisniederung ursprünglich geübt und von dort nach Indien und Ostasien, Arabien, Ägypten und die Länder des Mittelmeeres verbreitet wurde. Diese Meinung ist erschüttert, seit wir wissen, daß offenbar noch ältere Kalendersysteme bestanden, die erst auf Umwegen dorthin gelangten, wo wir bislang ältestes Kalenderweistum vermuteten.
Aus bestimmten Resten uralter Steinsetzungen Mittel- und Nordeuropas möchten sich darum bemühende Forscher längst verschollene Kulturen herauslesen. Es wäre in diesem Zusammenhang auch an die gewaltigen Steinkreise von Avebury und Oxford, in Schottland und in der Heide von Salisbury ("Steingehänge"), an die schon vom alten Herodot beschriebenen "Irrgärten" am Mörissee oder an solche bei Wisby auf Gotland zu denken. Was aber kündet uns der Sonnentorfries des mit Kalasasaya oder Sonnenwarte benannten Kultbaues dort oben beim Titikaka?
18 Monaten (!) schließen läßt, hat sich das Material über offenbar uralte Kalendersysteme fast unwahrscheinlich gehäuft. Die Struktur eines alten Mayakalenders läßt beispielsweise erkennen, daß er nicht nur Jahrtausende hindurch bis zum Einfall der Spanier befriedigend funktionieren konnte, sondern in mancher Hinsicht unserem heutigen Kalender noch überlegen war.
Bis in die Neuzeit hinein galt es für ausgemacht, daß ältester Kalenderbrauch in den alten Kulturzentren der Euphrat- und Tigrisniederung ursprünglich geübt und von dort nach Indien und Ostasien, Arabien, Ägypten und die Länder des Mittelmeeres verbreitet wurde. Diese Meinung ist erschüttert, seit wir wissen, daß offenbar noch ältere Kalendersysteme bestanden, die erst auf Umwegen dorthin gelangten, wo wir bislang ältestes Kalenderweistum vermuteten.
Aus bestimmten Resten uralter Steinsetzungen Mittel- und Nordeuropas möchten sich darum bemühende Forscher längst verschollene Kulturen herauslesen. Es wäre in diesem Zusammenhang auch an die gewaltigen Steinkreise von Avebury und Oxford, in Schottland und in der Heide von Salisbury ("Steingehänge"), an die schon vom alten Herodot beschriebenen "Irrgärten" am Mörissee oder an solche bei Wisby auf Gotland zu denken. Was aber kündet uns der Sonnentorfries des mit Kalasasaya oder Sonnenwarte benannten Kultbaues dort oben beim Titikaka?
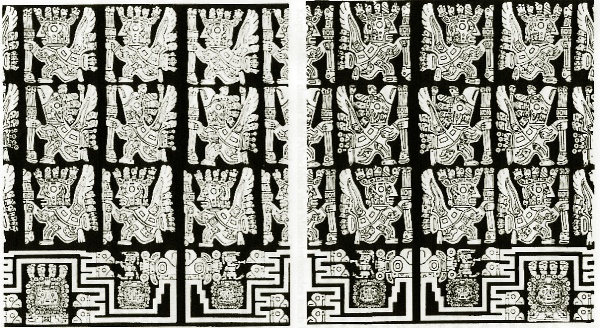
(Bildquelle/-text: Buch "Die Sintflut und
ihre Wiederkehr" von Behm, 1956)
Zeichnung des rechten und linken Friesteiles des Sonnentorkalenders mit einer Zäsur,
die an den straff hochgerichteten Kondorköpfen der untersten Friesreihe zu erkennen ist.
Zeichnung des rechten und linken Friesteiles des Sonnentorkalenders mit einer Zäsur,
die an den straff hochgerichteten Kondorköpfen der untersten Friesreihe zu erkennen ist.
Schon eine oberflächliche
Betrachtung läßt vermuten,
daß alle Einzelheiten der ein Strahlenantlitz darstellenden
Hauptfigur, noch alle Bildfeinheiten der flankierenden
Zepterträger, wie auch alle stilisierten (mit kranzartigen Zeichen
und Kondorköpfen umgebenen) Menschengesichter eines
Mäanderbandes bestimmte Sinnzeichen für Jahresabschnitte, ja
selbst Tage und Stunden, darstellen dürften. So treten im
Rahmen der figürlich dargestellten Jahresreihe des
Mäanderbandes zwei geharnischte und behelmte Trompeter auf.
Deren Friesanordnung beweist unzweideutig, daß es sich hier nur
um eine sinnbildliche Wiedergabe des sich wendenden Sonnenlaufes
handeln kann. Zudem deutet die Fußstellung der kleinen
Trompeterfiguren die wieder zurückkehrende Marschrichtung der
Sonne an, und die Spitzen der ausschreitenden Füße tragen je
einen Kopf des heiligen Sonnentieres Toxodon. Weiterhin ist die
Stellung der Trompeter in Übereinstimmung mit dem Stand der Sonne
zur Jahresmitte und zum Jahresende gebracht, der sich
bekanntermaßen auf der Südhalbkugel der Erde gerade
umgekehrt wie auf der Nordhalbkugel verhält.
Demnach ist nicht allzuschwer
zu entziffern, daß es den
Steinmetzen Urtihuanakus gelungen war, die Sonnenwenden und die Tages-
und Nachtgleichen figürlich darzustellen. Die
Schwierigkeiten der weiteren Entzifferung häuften sich erst dort,
wo die Suche nach einer Wiedergabe der Anzahl der Tage pro Jahr bzw.
pro Jahreszwölftel beginnt. Selbst dem in Tihuanaku-Fragen
als bisher unerreichte Autorität geltenden, inzwischen
verstorbenen Vorgeschichtsforscher Arthur Posnansky vom
Archäologischen Institut in La Paz gelang es nicht, den
steingehauenen Hieroglyphen die uns geläufigen Zahlen der
Jahrestage (365) und der Tagesstunden (24) abzulesen. Sobald er
darum bemüht war, hier zu einer wünschenswert befriedigenden
Lösung zu gelangen, blieb er genau besehen doch im Problemhaften
stecken oder mußte sich voraussetzungshalber höchst
willkürlicher Annahmen bedienen. "Nicht um die Breite eines Fingernagels
gelang es mir, wirklich in die Tiefe zu stoßen", bekannte
er vor etlichen Jahren einmal, als er zu dem Abguß des
Sonnentorfrieses in seinem Tihuanakuinstitut in Miraflores emporsah.
Dies konnte ihm auch kaum
gelingen, solange er in der üblichen
Vorstellung befangen blieb, daß durch alle Zeiten hindurch die
Zahl der Tage im Jahr und die Dauer der Tageszeit stets gleich
geblieben sind. Wer immer eines solchen Glaubens ist, wird sich
vergeblich darum bemühen, Tihuanakus Kalendergeheimnis jemals
enträtseln zu können. Lediglich das Sonnenjahr kann
zeitlich dem heutigen entsprochen haben, was sich mit der Vorstellung
eines Hinschrumpfens der Erde zur Sonne hin insofern verträgt, als
ein solcher Vorgang ein kosmisches Zeitmaß erfordert, das selbst
in Jahrhunderttausenden keine menschenmöglich feststellbare
Änderung der Sonnenjahrzeit gegeben zu sein braucht. Das
erklärt auch die leicht möglich gewordene Entzifferung der am
Sonnentorfries figürlich und sinnzeichenhaft zum Ausdruck
gebrachten Sonnenjahrvorgänge.
Um jedoch eine Änderung
der Zahl der Tage und damit
zusammenhängend der Monate im sichgleichbleibenden Sonnenjahr
gegeben und das möglicherweise am Sonnentorfries dargestellt zu
sehen, muß man sich schon mit der Lehrmeinung jener Kosmologen
befreunden, die den Todesweg eines Mondvorgängers und die dadurch
bewirkten Zeitlängenverschiebungen hinsichtlich der irdischen Tage
und Monate verteidigt. Obwohl uns das bereits plausibel wurde,
bleibt zu beachten, daß wir auch hier mit kosmischen
Zeitläufen zu werten haben und sich bei noch genügendem
Abstand des Mondes von der Erde irgendwelche Änderungen in der
Tagesdauer usw. nicht von heute auf morgen vollziehen sollten. Es
brauchten sich demnach viele Menschengenerationen, die während
eines Mond- kataklysmus nacheinander auf Tropenhöhen lebten,
zunächst keine Sorgen darüber zu machen, ob ihr Formen, Bauen
und Gestalten am Ende doch sinnlos ist. Eines ist sicher - wenn
der Sonnentorfries sich kalendar auf Himmelsbeobachtungen an einem
Tertiärmond (Vorgänger der Luna) gründet und
während einer Zeitepoche gefertigt wurde, da der Trabant unsere
Erde schon verhältnismäßig nahe umkreiste, sein
Erdumlauf die Erddrehung vielleicht schon zu überholen begann,
dann müßten ihm wohl oder übel andere Tageslängen
und dergleichen mehr als die gegenwärtigen abzulesen sein.
Wenn dies aber gelingt, stünde zugleich ein unerhört hohes
Alter des Torfrieses, das in die Jahrmillionen geht, außer
Zweifel.
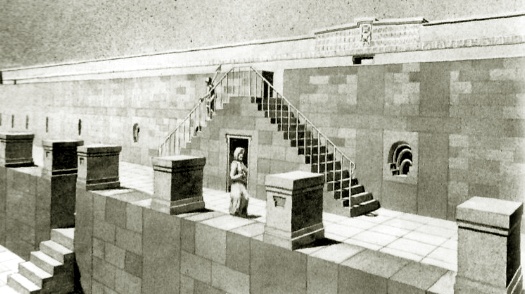
(Bildquelle/-text: Buch "Die Sintflut und
ihre Wiederkehr" von Behm, 1956)
Inneres der Sonnenwarte Kalasasaya in Tihuanaku. Nach einer Rekonstruktion von Reg.-Baurat Kiss. Auf dem obersten Stufenabsatz das Sonnentor.
Inneres der Sonnenwarte Kalasasaya in Tihuanaku. Nach einer Rekonstruktion von Reg.-Baurat Kiss. Auf dem obersten Stufenabsatz das Sonnentor.
Um hier die Probe aufs Exempel
zu machen, muß sich noch jeder an
die Friesenträtselung heranwagende Forscher des Rüstzeuges
von Kosmologen und Geologen bedienen, die aus astronomischen
Erwägungen und geologischen Entdeckungen heraus eine mondbedingte
Antlitzgestaltung des Erdkörpers für gegeben erachten oder
zum mindesten als brauchbares Untersuchungsmittel zu schätzen
wissen. Haben doch Strandlinienvermessungen zumal im Andenhoch-
land ergeben, daß hier vor Zeiten wesentlich andere
Bewässerungsverhältnisse als heutigentags geherrscht haben
müssen, daß das Weltmeer bis hoch hinauf zu den Andenketten
flutete, in äquatorialen Breiten beiläufig um runde 4000 m
höher als heute stand und die damalige Meseta ein anderes Bild als
heute bot. Ohne Zweifel standen ihre Gewässer mit dem
damaligen Weltmeer in Verbindung, sie war aber nicht gänzlich
überflutet, sondern der Titikaka und die weiteren Seen des
Hochlandes waren an Umfang mehrmals größer als heute.
Noch gegenwärtig entspricht der Salzgehalt mancher Mesetaseen dem
des Meeres, mag auch das Wasser des Titikaka infolge der durch Regen-
und Gletscherwasser bewirkten Aussüßung eher brakisch
sein. Viele der jetzt noch vorhandenen Salzseen und Lagunen
müssen vor Zeiten eine zusammenhängende Wasserfläche
gebildet haben und ebensowohl verraten uns Eigentümlichkeiten der
Landschaft, wie in der Atakamawüste und der Ostfalte der
Kordillere, wo ehedem die salzigen Wasser gestanden haben bzw. zur
chilenischen Küste hin wieder abgeströmt sind.

(Bildquelle: Dieses Foto wurde uns von
einer Leserin unserer Netzseite zur Verfügung gestellt.)
Ein Salzsee (Peru/Bolivien) der sich in einer Höhe von zirka 3600 m Höhe befindet.
Ein Salzsee (Peru/Bolivien) der sich in einer Höhe von zirka 3600 m Höhe befindet.
Von erheblicher Bedeutung
für unser Vorbringen ist eine besondere,
1926 von den Professoren Posnansky und Troll auf etwa 500 km Länge
hin genau nivellierte Strandlinie. Sie ist den Wänden der
flachen Berge, die vom Titikaka zum Pooposee und den diese beiden Seen
verbindenden Desaguodero-Flußlauf (in jeweils mäßiger
Entfernung der Gewässer) entlang streichen, deutlich
abzulesen. Die Strandlinie - in Gestalt ehemaliger
Uferablagerungen, vom Brandungsschlag bewirkter Felsauswaschungen, wie
sie eine längere Zeit hindurch ungefähr gleichbleibender
Wasserstand nach seinem Absinken hinterläßt - kennzeichnet
einwandfrei die Uferlinie eines ehedem zusammenhängenden breiten,
seenartigen Gewässers. Sie deutet auf eine (teilweise einem
Binnenmeer gleichende) weitgedehnte Wasserfläche mit darin
aufragenden Hochinseln auf der Meseta hin. Aber sie besagt uns
noch weit mehr.
Das Ruinenfeld von Tihuanaku
und damit die prähistorische
Sonnenwarte mit dem Sonnentor liegt heute rund 20 km vom Titikakasee
entfernt und etwa 27 m über dem heutigen Spiegel des Sees
erhöht. Die Strandlinie verläuft hier in gleicher
Höhe und läßt darauf schließen, daß
Urtihuanaku vor Zeiten einmal eine Hafenstadt am damaligen Binnenmeer,
d.h. einer von Gebirgsmauern umsäumten Seebucht mit Zugang zum
Weltmeer war. Da unter den nach und nach freigelegten Bauwerken
des Ruinenfeldes mindestens fünf als Häfen erkennbare Anlagen
und ein das ehemalige Stadtgebiet umschließender Hafenkanal
festzustellen sind, ist der Hafenstadtcharakter als solcher nicht
anzuzweifeln. Schon knapp hundert Meter nördlich der
Kalasasaya geben sich dereinst aus schweren Haussteinquadern gefertigte
Bauwerke eindeutig als die Molenmauern zweier rechteckiger Hafenbecken
zu erkennen. Die Übereinstimmung vom Strandlinien- und
Ruinenbefund wäre somit ein erstes Positivum im Rahmen der
Enträtselung Urtihuanakus.
Die Strandlinie als solche
besitzt nun die zunächst fatal
erscheinende Eigenschaft auf einer Strecke von 400 km hin um den Betrag
von 86 m nach Süden zu allmählich abzufallen. Dieser,
wenn auch nur geringe Abfall (also rund 20 cm pro km) läßt
sich nur so erklären, daß die Gleichgewichtslage der
Wassermassen auf Erden dereinst eine andere als heutigentags war,
daß mit anderen Worten der durch die Strandlinie markierte
Wasserspiegel im Falle eines Vermessens mit unseren heutigen
Meßinstrumenten durchaus als wagrecht und nicht etwa schräg
verlaufend registriert worden wäre! Fragen wir nach der
Ursache der veränderten Gleichgewichtslage der irdischen
Wassermassen in Vorzeittagen, so gehen wir nicht fehl, an die vom
Mondvorgänger äquatorwärts hochgesaugte Meeresflut zu
denken.
Unmittelbar vor und nach der
Zeit des eintägigen Monats
mußte sich ein Zustand eines jeweils mehrtausendjährigen
Beharrens der hoch hinauf in das Andengebiet reichenden Wassermassen
ergeben haben, wie ihn die uralte Strandlinie heute noch entsprechend
anzeigt. Ihr Verlauf entspricht im großen und ganzen der
annähernd zu berechnenden Flutringböschung in ihrem
südlichen, polwärts gerichteten Abfall. Würde das
Andenhochland auf der Nordhalbkugel der Erde liegen, so
müßte die Strandlinie nach Norden zu abfallen.
Daß jedenfalls das Meseta-Meeresbuchtgebiet mit seinen für
die damalige Menschheit geeigneten Inselbereichen in Wirklichkeit
keinen schief verlaufenden Wasserspiegel besaß (den es
erfahrungsgemäß auch gar nicht geben kann), die Strandlinie
aber dennoch etwas schief verläuft, resultiert darin, daß
die Normalen zu den Radien der Erde einstmals durch das Vorhandensein
des immerhin schon recht erdnahen Tertiärmond (Vorgänger der
Luna) verschoben war. Damit wäre ein weiteres Positivum zu
verzeichnen, das Urtihuanaku zeitlich in die Jahrmillionenferne
rückt.
Genauer besehen haben wir mit
einer erdgeschichtlichen Zeitspanne zu
werten, da der Tertiärmond den eintägigen Monat knapp hinter
sich hat, sein Todesweg zur Erde hin sich bereits auf dem absteigenden
Ast bewegt. Forscher, die, etwa wie Hörbiger,
sich darum bemühten, die astronomischen und kalendaren
Zustände zu dieser Zeitspanne ebenfalls zu ergründen, sind
der Meinung, daß im gleichen Sonnenjahr wie heute die Tagesdauer
dazumal 29,4 Stunden, die Anzahl der Tage etwa 298 bei 447
Tertiär-Mondumläufen, demnach 37 bis 38 pro
Jahreszwölftel, betragen hat und schätzungsweise 200
Sonnenfinsternisse stattgefunden haben.
Die Frage liegt nun nahe, ob der Sonnentorfries möglicherweise von Steinmetzen gefertigt sein könnte, welche die so fern liegenden Zeiten als Angehörige einer hochentwickelten Kultur durchstanden und somit ein von unserem heutigen völlig abweichendes Kalendersystem steingemeißelt nachgelassen haben. Um eine Beantwortung dieser Frage hat sich der vor dem letzten Weltkrieg zeitweilig in Tihuanaku forschende Regierungsbaurat Edmund Kiss nach Kenntnis der obigen Zahlwerte redlich bemüht. Sollten diese etwa auch dem uralten Tihuanakukalender abzulesen sein? Sein dem Sonnentorfries tatsächlich herausgelesenes - auf die kürzeste Formel gebrachtes - Ergebnis lautet: Tagesdauer 30,2 Stunden, Zahl der Tage 290, Tertiär-Mondumläufe 447 (pro Jahreszwölftel 37,2) und Sonnenfinsternisse 204 - alles pro Sonnenjahr!
Die Frage liegt nun nahe, ob der Sonnentorfries möglicherweise von Steinmetzen gefertigt sein könnte, welche die so fern liegenden Zeiten als Angehörige einer hochentwickelten Kultur durchstanden und somit ein von unserem heutigen völlig abweichendes Kalendersystem steingemeißelt nachgelassen haben. Um eine Beantwortung dieser Frage hat sich der vor dem letzten Weltkrieg zeitweilig in Tihuanaku forschende Regierungsbaurat Edmund Kiss nach Kenntnis der obigen Zahlwerte redlich bemüht. Sollten diese etwa auch dem uralten Tihuanakukalender abzulesen sein? Sein dem Sonnentorfries tatsächlich herausgelesenes - auf die kürzeste Formel gebrachtes - Ergebnis lautet: Tagesdauer 30,2 Stunden, Zahl der Tage 290, Tertiär-Mondumläufe 447 (pro Jahreszwölftel 37,2) und Sonnenfinsternisse 204 - alles pro Sonnenjahr!
Die im großen und ganzen
völlige Übereinstimmung der
Zahlwerte ist derart verblüffend, daß an einen Zufall nicht
zu denken ist. Nicht nur das Kalender- geheimnis Tihuanakus als
solches scheint demnach enträtselt zu sein, sondern unsere gesamte
Kulturforschung wird sich daran gewöhnen müssen, mit weit
ausgedehnteren Zeitläufen zu werten, als sie sich das bislang nur
träumen ließ. Läßt einerseits eine uralte
Standlinie auf das hohe Alter bestimmter Bauten Urtihuanakus
schließen, deren Hafenanlagen mit der sie schneidenden Standlinie
in Einklang stehen, so stellen andrerseits die entzifferten
Ideographien am Sonnentor eine vollwertige Gegenprobe aufs Exempel dar.
Fassen wir einige Bauwerke des
Ruinenfeldes noch etwas näher ins
Auge oder nehmen wir die geologische Beschaffenheit der Meseta und
ihrer Gebirgsumrandung noch etwas unter die Lupe, schwinden jede
Zweifel an der Realität der hier einst stattgefundenen
Gewaltabspiele.
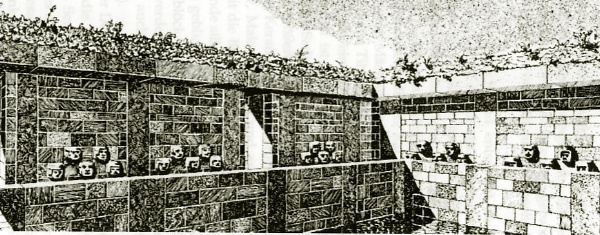
(Bildquelle/-text: Buch "Die Sintflut und
ihre Wiederkehr" von Behm, 1956)
Der alte Tempel in Tihuanaku mit dem eigenartigen Fries von Porträtsköpfen dich über dem Fußboden.
Nach einem Rekonstruktions-Schaubild von Reg.-Baurat Kiss.
Der alte Tempel in Tihuanaku mit dem eigenartigen Fries von Porträtsköpfen dich über dem Fußboden.
Nach einem Rekonstruktions-Schaubild von Reg.-Baurat Kiss.
Sehr hohen Alters wie auch die
Anlage der Kalasasaya dürften die
Reste eines ursprünglich in die Erde hinein gebauten,
vorläufig mit "Alter Tempel" umschriebenen Bauwerkes sein.
Die dicken Mauern sind zwischen megalithische Pfeiler eingelassen, mit
denen sie in der Fläche bündig liegen. Damit sie nicht
zwischen den Pfeilern herausfallen, sind sie mit Nut und Feder in sie
eingefügt. Dieser soliden Bauart ist es zu verdanken,
daß die Wände über undenkliche Zeiträume hin
wenigstens in ihren unteren Teilen einigermaßen erhalten blieben,
im übrigen auch infolge ihres Erdeinbaues keiner wesentlichen
Verwitterung ausgesetzt waren. Bemerkenswert und vom Schauer des
Geheimnisvollen umwebt sind eigenartige, den Innenwänden
eingelassene inzwischen inkrustierte Porträtköpfe, die einer
Ahnengalerie entsprechen dürften. Der Einbau in den
Felsboden und die Verwendung künstlicher Mittel gegen
Einsturzgefahr spricht für Erdbebenschutz, wie ein solcher
während einer Zeitspanne ungewöhnlicher Beben geraten sein
mußte. Das dürfte auch für merkwürdig
engräumige Gelasse gelten, die sich unter dem Erdboden befanden
und hinsichtlich ihrer Bauweise gegen Bebenstöße
hervorragend gesichert waren, vielleicht auch einen willkommenen
Unterschlupf gegenüber Aschenregen der Vulkane und nicht zuletzt
gegenüber Großhagel und niederbrechenden Mondtrümmern
boten. Verschiedene der über das Ruinenfeld, auch über
das Weichbild der modernen Stadt Tihuanaku zerstreuten Gelasse, die man
allenthalben mit "unterirdischen Wohnungen" bezeichnen kann, werden
heute noch von indianischen Bewohnern als Keller benutzt.
Auf ein sehr großes, 200
x 200 m umspannendes festungsartiges
Bauwerk, das dereinst auf einem offenbar künstlich
aufgeschütteten Berg errichtet war, weisen dessen allenthalben
freigelegte Stützmauern hin. Zum Teil sind auch die
Grundmauern verschiedener Gebäude erhalten, die ehedem auf der
oberen Plattform der Festung, der man den Namen Akapana verliehen hat,
festgefügt standen. Für einen ursprünglich auf der
Plattform befindlichen Teich spricht eine hier ausmündende
Entwässerungsleitung, deren Beginn infolge der einstmaligen
Verwendung schwerer Hausteinplatten und Andesitblöcke fast
vollständig erhalten blieb. Auch Akapana, das bei einer
Versuchsrekonstruktion gleichsam den Eindruck eines bombensicheren
Bunkers erweckt, dürfte den urältesten Bauten Urtihuanakus
hinzuzuzählen sein.
Schließlich sei, ohne das
Ruinenfeld auf seine weiteren Bauwerke
hin abzutasten, noch auf die merkwürdigen Terrassenbauten, von den
Eingeborenen Andenes benannt, hingewiesen. Es handelt sich hier
um landwirtschaftlich genutzte Stufenäcker, deren
Stützgemäuer ein Wegspülen der Ackerkrume
verhindert. Sie bedecken in einer Länge von etwa 2000 km und
einer Breite, die dem Abstand (etwa 200 km) der beiden Kordilleren
entspricht, alle Berge bis in die hohen Gipfelgebiete hinauf, finden
sich selbst auf dem Illimani, dem Granitklotz bei La Paz in über
5000 m Höhe. Sie würden sich wahrscheinlich auch noch
höher hinauf entdecken lassen, wenn der Schnee einmal
verschwände, der in der geologischen Gegenwart auch unter
heißer Sonne hier dauernd liegen bleibt. Nicht nur die
Berge Boliviens, sondern auch die von Peru auf der Strecke vom
Titikakahafen Puno bis nach Cuzco und darüber hinaus sind mit
solchen Terrassenbauten übersät, die von der Tiefe gesehen
gleich zarten Notenlinien wirken und die um so besser erhalten und
damit vor menschlicher Zerstörung bewahrt sind, je höher sie
liegen. Es ist kaum zu errechnen, welche gewaltige Gesamtstrecke
die hundertfach übereinandergetürmten Kunstbauten wohl
ausmachen, wie oft sie wohl, aneinandergereiht, den Erdball
umspannten! Einige der nicht allzuhoch gelegenen Terrassen werden
heute noch von einsichtigen Indianern genutzt, sofern diese den Wert
der Terrassen als Humus- und Feuchtigkeitssammler erkannt haben.
Solche Ackerbauterrassen
dürften zweifelsohne in jenen Zeiten
angelegt worden sein, da die Menschheit nach und nach in die
Andenhochberge, in die Meseta gedrängt wurde, weil (abgesehen von
wenigen weiteren Erdgebieten, wie etwa dem abessinischen Hochland mit
ähnlichen Terrassen) grundsätzlich kein Lebensraum für
Menschen mehr bestand, die sich noch Generationen hindurch hier
kulturell betätigen konnten und Beweise dafür der Nachwelt
hinterlassen haben. Das Zeitalter der Terrassenanlagen kann somit
nur dasjenige der vom erdnahen Mondvorgänger
äquatorwärts hochgestauten Meeresflut gewesen sein. Den
damaligen Terrassenbauern müssen selbstredend die uns
Gegenwärtigen hoch anmutenden Kordilleren infolge des um etliche
tausend Meter höher liegenden Ozeanspiegels weit niedriger,
geradezu als mäßig hohe Berge oder Hügel erschienen
sein.
Diese Berggebiete waren dazumal
nicht mit Schnee bedeckt, denn einmal
lagen sie dem hochangestiegenen Meeresspiegel weit näher als je
zuvor, überragten diesen um allenfalls 2000 bis 3000 m und zum
andern mußten die vom Mondvorgänger hier dichtgetürmten
und gleichsam emporgesaugten Luftmassen ebenfalls dem Zustandekommen
eines verhältnismäßig milden Klimas Vorschub
leisten. So war es den Menschen sehr wohl möglich, hier oben
Ackerbau zu treiben und auf den endlosen Terrassen Nahrung für
alle zu schaffen, die sich auf der Meseta als einem Asyl von
Dauerbestand im Verlaufe der Zeiten angesiedelt hatten. War doch
die übrige Erde zur damaligen Zeit nahezu unbewohnbar. Was
aber das in den äquatornahen Gebieten steigende Meer den Menschen
an Lebensraum weggenommen hatte, ersetzte ihnen jetzt eine der
Agrikultur zuträgliche Wärme. Weiterhin dürften
die Mesetagewässer in dieser fern verrauschten Erdenzeit
äußerst fischreich gewesen sein, dürften auch über
erheblich große Fische verfügt haben, wie es ergrabene Reste
der ehemaligen Fischfauna augenfällig machen.
Ähnlich wie an den Ufern
des heutigen Titikaka Unmassen von
Kalkalgen gedeihen, hielten deren Vorläufer die flachen Uferteile
der damals viel weiter ausgedehnten Mesetagewässer besetzt.
Pausenlos sanken die kalkigen Reste der ihren Lebensreigen jeweils
beendeten Algen ab, schichteten sich meterdick auf, wurden
späterhin trockengelegt und verfestigt und lassen sich heute auf
kilometerweiten Strecken hin entdecken. Zum großen Teil
helfen die Niederschläge kalkhaltiger Algenarten mit, ehemalige
Ufermarken bzw. Strandlinien als solche zu erkennen.
Kalkablagerungen ähnlicher
Natur sind wohlweislich auch auf den
Steinquadern verschiedener Ruinenteile Urtihuanakus
festzustellen. So sind beispielsweise die Stufen der Freitreppe
Kalasasayas mit einem derart festen Kalkbelag überzogen, daß
es nicht leicht fällt, etwas davon abzukratzen und
Untersuchungszwecken zugänglich zu machen. Das deutet darauf
hin, daß die Bauwerke vorübergehend unter Wasser gerieten,
verträgt sich aber wiederum mit der Folgerung, daß bei
bedrohlicher Annäherung des Mondvorgängers die sich
ständig mehr einengende und rasend umlaufende
Meeresgürtelflut noch entsprechend höher ansteigen und auch
die Gewässer der Meseta in Mitleidenschaft ziehen
mußte.
Auch hierfür spielt uns das Naturgeschehen einen geradezu wundersamen Zeugen in die Hand. Es handelt sich weniger um eine eigentliche Strandlinie mit ausgesprochenen Brandungshohlkehlen und festverkitteten Kalkbändern, sondern mehr um eine durch einen Muschelhorizont gekennzeichnete Ufermarke, offenbar eine solche, die uns den einstmals höchsten Stand der Meseta-Wasseransammlung verrät. Dafür spricht vor allem der Umstand, daß die Pfahlmuschelreste der Vorferne im Zuge des Ufermarkenverlaufs noch heute offen zutage liegen, massenweise eingesammelt werden können, somit weder zu Kalkstein gepreßt wurden, noch späterhin unter irgendwelchen Druck gerieten. Heutigen Indianern liegt es ob, aus den überkommenen Muschelresten recht brauchbaren Maurerkalk zu brennen. Der Verlauf der stellenweise verwaschenen oder unterbrochenen Ufermarke stimmt im ungefähren mit demjenigen der uns bereits bekannten und Urtihuanaku berührenden Strandlinie überein, nur daß die Ufermarke wenige hundert Meter höher sich hinzieht.
Auch hierfür spielt uns das Naturgeschehen einen geradezu wundersamen Zeugen in die Hand. Es handelt sich weniger um eine eigentliche Strandlinie mit ausgesprochenen Brandungshohlkehlen und festverkitteten Kalkbändern, sondern mehr um eine durch einen Muschelhorizont gekennzeichnete Ufermarke, offenbar eine solche, die uns den einstmals höchsten Stand der Meseta-Wasseransammlung verrät. Dafür spricht vor allem der Umstand, daß die Pfahlmuschelreste der Vorferne im Zuge des Ufermarkenverlaufs noch heute offen zutage liegen, massenweise eingesammelt werden können, somit weder zu Kalkstein gepreßt wurden, noch späterhin unter irgendwelchen Druck gerieten. Heutigen Indianern liegt es ob, aus den überkommenen Muschelresten recht brauchbaren Maurerkalk zu brennen. Der Verlauf der stellenweise verwaschenen oder unterbrochenen Ufermarke stimmt im ungefähren mit demjenigen der uns bereits bekannten und Urtihuanaku berührenden Strandlinie überein, nur daß die Ufermarke wenige hundert Meter höher sich hinzieht.
Der Befund läßt
darauf schließen, daß die
Mesetabewohner trotz des Verlustes ihrer Metropole sich nach und nach
immer höher hinauf in die Berge begaben, auch ihre
Ackerbauterrassen ständig höher anlegten, um somit die Reste
des Bodens, die ihnen höhere Gewalt überließ, zur
Gewinnung des täglichen Brotes ausnutzen zu können. So
erklärt sich wiederum das heutige Bild der restgebliebenen
Agrarterrassen, die ehedem nicht ausnahmslos auf einmal angelegt wurden
bzw. gleichzeitig in Benutzung standen. Sicherlich haben die
letzten der bergehoch gedrängten Menschengeschlechter keine
weiteren Kulturbauten mehr errichtet, zumal der Erdball allmählich
im Zeichen einer unmittelbar bevorstehenden Mondauflösung
stand. Hatten doch die nunmehr oberhalb der höchsten
Wasseransammlung hausenden Menschen ganz unter dem Zwielicht des
niederbruchbereiten Mondvorgängers, unter einer
wolkenverhüllten und wechselweise verdunkelten Sonne, unter
Kaltstürmen, Hagelunwettern und sonstwie entfesselten
Naturgewalten zu leiden. Angesichts des riesenhaften Mondes
dürften die Menschen der damaligen Zeit sehr wohl gefühlt
haben, daß dem Erdball so etwas wie ein Jüngstes Gericht
bevorstand. Prasselten aber erst die ersten zentnerschweren
Hagelschauer nieder, denen eisenharte Mondtrümmer folgten, war es
für viele gewiß nicht leicht, sich im letzten Augenblick
noch in einer Felskammer schützend zu bergen. Damit war
zugleich der Zeitpunkt des Abflusses der riesenhaft angestauten
Gürtelmeerflut gekommen, was für die Menschen hier oben eine
Entlastung von den sie umgebenden Wassermassen bedeutete, indessen sich
auf der weiteren Erdoberfläche das unter Großbeben sich
vollziehende Sintflutgeschehen abspielte.
Die Wirkung der mit
unvorstellbarer Wucht und Schnelle
abströmenden Wasser erkennt man noch heute mit erschütternder
Deutlichkeit, sobald man die drei riesigen Terrassen der
Küstenkordillere am zweckmäßigsten per Mula
durchquert. Ob man nun von Arika nach Takna reitet und von dort
über die Küstenande emporsteigt, oder ob man mit der Bahn
Arika-La Paz die wüsten Strecken durcheilt, die von Gigantenhand
durcheinandergewühlt und mit unendlichen Schuttmassen
überstrudelt zu sein scheinen, oder ob man von Mollendo aus nach
Cuzco durch die Wüste reist, in der Arequipa unter
Eukalyptusbäumen ruht - überall bietet sich das gleiche Bild
ungeheuren Geschehens und beispielloser Wasserfluten! Wenn
kurzsichtige Geologen behaupten, daß dies alles vielleicht
Gletscherarbeit sei, so hat ihnen bereits Posnansky entgegnet,
daß solche Gletscher allenfalls auf dem Jupiter liegen
müßten, um eine Arbeit zu verrichten, wie sie in Hunderten
von Kilometern Breite tatsächlich geleistet worden ist. Hier
bleibt nichts anderes übrig, als die Schuttberge und
Trümmerfelder für zweifellos fluviatielen, somit
flutbewirkten Ursprungs zu halten.
Schrieb uns doch der bereits
genannte E. Kiss, der mit Posnansky und
weiteren Gelehrten eng zusammenarbeitete, vor Jahren einmal, daß
beim Anblick dessen, was in der Küstenkordillere geschehen sei,
selbst ein heftiger Gegner geologischer Katastrophen nicht mehr mit
ehrlichem Gewissen sagen könne, das alles sei ganz allmählich
geschehen oder es sei eine Wirkung der gewiß recht heftigen
Tropenregen. "Und wenn Lyell
(der Vater des Gedankens eines ständigen geologischen
Gleichgeschehens, Verf.) Gelegenheit
gehabt hätte, von Mollendo nach Arequipa durch die
Felsenwüste zu reiten, so würde er nach seiner Rückkehr
Abbitte für das geleistet haben, was er in der wissenschaftlichen
Welt angerichtet hat. Denn bei der Betrachtung einer einzigen
Quebrada, einer beliebigen Schlucht, die sich durch eine der drei
gigantischen Andenterrassen zieht, würde er gesehen haben,
daß hier ganze Berge grauer Felsen von unermeßlichen Fluten
mit Geröll und Sand übereinander und zusammengestrudelt
worden sind, als seien es leichte Späne von Kork und Holz.
Und wenn man staunend vor dem Ergebnis solcher Naturgewalten steht, so
glaubt man auf einem fremden Planeten zu sein und nicht auf der Mutter
Erde, die an anderen Stellen ihres weiten Rundes einen so sanften
Eindruck macht. Mag es sonst auf der Erde für den Geologen
genug interessante Dinge geben, die er kennt und über die er sich
nicht wundert, in den Kordilleren lernt er geradezu beten - und
vielleicht auch nachdenklich werden!"
Ist es doch bezeichnend, aus dem Munde eines alten Indio zu vernehmen, daß seine Vorfahren eine Berge überrennende Flut miterlebten und Teile der Felsengebirge heute noch versteinerten Wellen gleichen!
Ist es doch bezeichnend, aus dem Munde eines alten Indio zu vernehmen, daß seine Vorfahren eine Berge überrennende Flut miterlebten und Teile der Felsengebirge heute noch versteinerten Wellen gleichen!
.................................
Sind doch alle Gelehrten, die der Meseta wie dem Andengebiet überhaupt ihr besonderes Interesse schenkten bzw. eine Lebensarbeit daransetzten, der Ansicht, daß hier durch jeweils größere Zeiträume getrennte verschiedene Kulturen blühten und wieder verschwanden, ein Vorgang, der unserer Meinung nach tatsächlich erst durch den Hineinbezug kosmischer Gewalten deutbar zu werden scheint und die hier rankende reiche Problematik verringert.
Sind doch alle Gelehrten, die der Meseta wie dem Andengebiet überhaupt ihr besonderes Interesse schenkten bzw. eine Lebensarbeit daransetzten, der Ansicht, daß hier durch jeweils größere Zeiträume getrennte verschiedene Kulturen blühten und wieder verschwanden, ein Vorgang, der unserer Meinung nach tatsächlich erst durch den Hineinbezug kosmischer Gewalten deutbar zu werden scheint und die hier rankende reiche Problematik verringert.
Schon der Amerikaner William
Prescott, der vor reichlich hundert Jahren
die Mitwelt mit der Kultur der Azteken und Inkas vertraut machte,
glaubte die Vermutung aussprechen zu dürfen, daß schon lange
vor der Zeit der Inkas ein in der Bildung sehr vorgeschrittenes
Menschengeschlecht in Südamerika lebte. In der Nähe des
Titikakasees würde dieses Geschlecht beheimatet gewesen sein,
dessen Ergründung eine dankbare Aufgabe des sinnenden
Altertumsforschers sei. Aber - so meinte Prescott - es sei ein
Land der Finsternis, das weit über das Gebiet der eigentlichen
Geschichte hinausreiche. Damit hatte der verdiente Forscher des
alten Amerika den Nagel auf den Kopf getroffen. In unserem
zwanzigsten Jahrhundert aber konnte sich Posnansky anläßlich
besonderer Bauwerkfunde, die er in einer Bucht des Titikaka auf der
Insel Siminake 1931 entdeckte, nicht der Worte enthalten: "Unzweifelhaft ist die Kultur von Siminake
ganz unendlich alt, denn das Bauwerk mit seinen über drei Meter
dicken Mauern muß schon vor der Eiszeit entstanden sein, als der
Titikaka noch nicht so groß war wie heute und erst späterhin
seine Wasser über die Meseta reckte."
Dies mögen jene verstehen,
die als Verteidiger der, wenn auch seit
Darwins Tagen reichlich gemodelten, Abstammungslehre oder auch als
Archäologen daran Anstoß nehmen, jahrmillionenferne Kulturen
der Menschheit mit kühler Gelassenheit für real zu
halten. Doch gegenüber ersichtlichen Beweisgründen
für ein außerordentlich hohes Alter der Menschheit und deren
jeweils selbständigen, nicht etwa auf ein billiges
Entwicklungsnacheinander basierenden Kulturen, lassen sich heute keine
stichhaltigen Einwände mehr machen. Schließlich sind
schon genügend viele biologisch, anatomisch, geologisch,
prähistorisch oder auch kulturgeschichtlich geschulte Forscher auf
bestem Wege wertvolle Pionierarbeit zu leisten, die in eine völlig
Neuorientierung aller das Menschengeschlecht und seine noch offenen
Rätsel berührenden Dinge einmünden wird.
Einfang der Luna - Ende Tihuanakus
Noch blüht erdenweit
mondlose Kultur, empfindet das Leben allgemein die Ruhe des
Erdsterns. Doch allmählich künden sich die Vorboten des
Mondeinfanges an, lange bevor noch der Nochplanet seinen Himmelspfad um
die Erde schlingt. Langsamer als die Erde umläuft er die
Sonne, doch alle paar Jahre kommt die Erde zwischen ihn und die Sonne
zu stehen (Opposition). Dann ist sein Abstand von der Erde
jeweils am geringsten und etliche Wochen hindurch spielen beide
Himmelskörper ihre Kräfte bereits gegeneinander aus.
Unterirdische Gewalten werden in der Erdkruste wach, lösen Beben
aus, die Meergewässer erfahren eine Störung.
Tieferliegende Strandgebiete werden überschwemmt und der
kultivierte Mensch der damaligen Zeit nimmt solche Vorboten des
kommenden Mondeinfangs gewissermaßen als kosmische Warnungen hin.
Diese Warnungen gewinnen an
Ausmaß, je mehr der merkwürdige Nochplanet von Opposition zu
Opposition an Größe zunimmt und schließlich einem
Planetenscheibchen von geringer Tellergröße gleicht.
Sofern ein Sterngucker der damaligen Zeit mit einem Teleskop hätte
arbeiten können (was immerhin im Bereich des Möglichen
liegt), stellt er fest, daß der unheimliche Himmelskörper
sich merklich verändert. Ehedem glänzende Flächen
werden dunkler und eigentümliche Nebelschwaden breiten sich
über das Gestirn aus. Die Kräfte der Erde beginnen
wohlverstanden seine bisherige Oberfläche zu zerstören und
modellieren jenes Oberflächengefüge zurecht, wie wir es im
ungefähren unserem Erdmond noch heute abzulesen
vermögen. Sehr tumultarisch geht es damals auf der
Oberfläche des unmittelbar vor seinem Erdeinfang stehenden
Himmelskörpers zu. Seine dicke Eiskruste zerbricht,
Wasserströme treten von innen heraus, Ureisschollen zerknicken,
treiben umher, bis wieder alles fest niederfriert. Weiterhin
bremst die Erde die ursprüngliche Eigendrehung des mondwerdenden
Körpers ab, saugt den letzten Rest seiner Lufthülle hinweg,
so daß eine heftige Wasserdampfung und Eisverdunstung eingeleitet
wird, als deren Folge eine Art Kometenschweif hinter dem Gestirn
einherzieht. Das alles läßt die Menschen wahrlich
nicht gleichgültig, zumal an schwerwiegenden Erdstößen
und plötzlich aufflammenden Vulkankratern kein Mangel ist.

(Bildquelle/-text: Buch "Die Sintflut und
ihre Wiederkehr" von Behm, 1956)
Schema eines Mondeinfanges - ein vordem selbständiger Planet wird Erdmond. Links oben: vom Strahlungsdruck der Sonne abgetriebene Partikelchen.
Lb = einstige Planetenbahn des werdenden Mondes. MEb = Mondeinfangsbahn. kMb = angenäherte heutige Mondbahn.
Schema eines Mondeinfanges - ein vordem selbständiger Planet wird Erdmond. Links oben: vom Strahlungsdruck der Sonne abgetriebene Partikelchen.
Lb = einstige Planetenbahn des werdenden Mondes. MEb = Mondeinfangsbahn. kMb = angenäherte heutige Mondbahn.
Sobald jedoch die Schwerkraft
der Erde die Einschwenkung des Nachbargestirns in eine Mondbahn
bewirkt, d.h. der Augenblick des eigentlichen Gestirneinfanges erreicht
ist, erlebt die Erde einen allgewaltigen Schicksalstag. Die
Eingliederung der Mondbahn in die Äquatorebene der Erde und die
ebenso plötzlich eintretenden Gewalteinwirkungen der beiden
Himmelskörper zueinander lassen das Ozeanwasser der Erde in
Windeseile äquatorwärts stürmen. Ein ungeheurer
Wogenschwall läßt das Inselreich Atlantis
sturmüberflutet niederbrechen, ähnlich rasch, wie es die
Überlieferung vermeldet. Gleich zwei Rennfahrern, von denen
der kleine äußere den größeren inneren um einen
Bruchteil überholt, folgen im Augenblick des Einfangens Erde und
Mond noch um die Sonne. Dem kleineren war aber jetzt nicht mehr
die Kraft gegeben, selbständig weiterzurasen, sondern von
unsichtbaren Mächten des größeren gefesselt wurde er
von diesem vorn übergeschwenkt. Während das in
Wirklichkeit zu einem Zusammenprall der beiden führen
müßte, denken wir uns nun den größeren
weitersausen und den kleineren von dieser Sausfahrt mitgerissen, dabei
den größeren dauernd umfahrend. Zunächst als
gestreckte Ellipse, deren größere Achse beim öfteren
Umkreisen um die Erde schließlich immer kleiner wurde, d.h. die
Ellipse sich immer kreisähnlicher ausrundete, um schließlich
die Gestalt der heutigen Mondbahn anzunehmen. Eine
endgültige Einregelung der heutigen Mondbahn vollzog sich zwar
nicht von heute auf morgen, sondern währte etliche Jahrhunderte,
wenn nicht Jahrtausende.
Inzwischen waren aber die
Nachwehen mondeinfangbedingter Erdkatastrophen zur Ruhe gekommen.
Wohl hat das Mondeinfangspiel die Erde gehörig bedrängt, doch
nicht allerorten auf Erden war der Mensch den damit verbundenen
Schrecknissen ausgesetzt und nicht für ewige Zeiten sollte die
nachsintflutliche bzw. vormondliche Atlantiskultur infolge ihrer
erdweiten Verbreitung begraben werden. Während z.B. Menschen
in manchen Gebieten der mittleren und höheren Breiten von den
Mondeinfangfluten kaum erfaßt oder nur mäßig betroffen
wurden und eher unter Erdbeben zu leiden hatten, muß es Bewohnern
des Andenhochgebietes und damit auch der Meseta weniger glimpflich
ergangen sein. Daß hier oben wieder Kulturen blühten,
nachdem die Meseta unmittelbar nach der Sintflut wohl für lange
Zeiten hindurch unbewohnt war, läßt sich nur so verstehen,
daß dieses Mesetagebiet gleichsam wie ein Magnet auf Menschen
irgendwelcher Zeiten einwirkte, daß es einem in den menschlichen
Generationenfolgen unvergessen bleibenden Kulturheiligtum entsprach.
An sich hatten es
Menschengruppen während der mondlosen Zeit nicht nötig, die
Meseta etwa als Ausweichgebiet vor Naturgewalten aufzusuchen.
Aber sie taten es dennoch, wie es die Ruinenbefunde eindeutig
beweisen. Hier oben beim Titikaka fand tatsächlich ein
Kommen und Gehen von Kulturen statt. Zu wiederholten Malen wurde
an nachgelassenen Bauwerksresten längst abgesunkener Vorfahren
wieder gebessert und weitergebaut. So wollen die berufendsten
Forscher der hier in Frage kommenden Materie verstanden sein. In
die Perspektive mondbedingter Erdtragödien gerückt
können wir auch sagen: Hier haben Menschen bereits zur
vorsintflutlichen Ringmeerflut geweilt und prachtvolle Bauten
errichtet. Hier haben Menschengeschlechter die Sintflut
durchstanden und deren Abströmen erlebt, und hier haben weit
spätere Geschlechter über Kulturtrümmern der Vorferne
erneut geformt und gestaltet, vielleicht solche, die als atlantische
Kolonisatoren hierher fanden und Meisterwerke atlantischer Kultur
nachließen. Es sollte die Tragik auch dieser
Glücklichen sein, inmitten eines besonnten Daseins geradezu
urplötzlich zugrunde zu gehen.
Bei der Durchmusterung der
Ruinenfelder fällt es dem Beschauer merkwürdig
überraschend auf, daß reichlich viele Bauarbeiten, die
Zeugen der zeitlich jüngsten Kulturepoche auf der Meseta sind,
plötzlich eingestellt sein mußten. Eine Stadt - nennen
wir sie jetzt Alttihuanaku - die offenbar im zügigen Aufbau mit
Prunkbauten stand, wurde gleichsam Hals über Kopf an diesem Ausbau
behindert! Ein fein ziseliertes Maurerlot liegt beispielsweise
neben einem Meißel aus gehärteter Bronze am Fuße eines
eben begonnenen Werkstückes, das bis auf den heutigen Tag nicht
vollendet wurde. Mit sauber gemeißelten Nischen und
Ornamenten versehene Hausteinblöcke stehen aufgereiht und fertig
zum Versetzen wie auch das Hauptgesimse eines wahrscheinlich
mausoleumartigen Baues. Inmitten einer Bauanlage stehen
trachytene Gußformen bereit, darinnen die Bronzedübel und
Klammern gegossen wurden, mit denen man die Werksteine untereinander
verband. Nahe der Kalasasaya liegen gewaltige Gesimse, die gerade
vollendet werden sollten. Auch eine von getrocknetem Schlamm
bedeckte Büste wurde aufgefunden, der nur eine edel geformte
Menschengestalt als Vorbild gedient haben kann.

(Bildquelle/-text: Buch "Die Sintflut und
ihre Wiederkehr" von Behm, 1956)
Gesamtansicht des Ruinenfeldes von Puma-Punktu in Tihuanaku.
Gesamtansicht des Ruinenfeldes von Puma-Punktu in Tihuanaku.
Das alles spricht deutlich
dafür, daß die Schöpfer und Baumeister der in Arbeit
befindlichen Bauten dereinst von einer grauenhaften Katastrophe
überrascht wurden und nicht etwa freiwillig ihre
Arbeitsplätze verlassen haben. Daß dieser Katastrophe
eine Unzahl von Menschen und Tieren zum Opfer fielen, verraten deren
Gebeine, die dem grauweißen Ton des Untergrundes und der weiteren
Umgebung massenhaft eingestreut sind. Die Zahl dieser Gebeine ist
so groß, daß es Hunderttausende gewesen sein müssen,
die hier ein plötzliches Ende fanden. Offenbar hat es sich
aber nicht nur um Eingesessene Alttihuanakus wie auch weitere der
Meseta gehandelt, die hier zugrunde gingen, sondern um sehr
verschiedene Völker der Menschheit. Sollte es sich
vielleicht zum Teil um Wallfahrer handeln, die von weither kamen, sich
hier zu einem kultischen Großfest ein Stelldichein gaben und im
Augenblick frömmiger Zuversicht gleichsam zur Hölle
fuhren? Auch dieser Gedanke wurde einmal ausgesprochen. Das
würde zugleich erneut dafür sprechen, daß hier im
Andenhochland sich eine Kultstätte weltbürgerlichen
Ausmaßes breitete, ein Symbol ewiger Gotteskindschaft aller
Menschen der Erde!
Daß in erster Linie ein
Flutgeschehen für das Vernichtungswerk in Frage kommt, steht
einwandfrei fest. Hiervon überzeugt im besonderen wieder ein
Gebiet am Illimani-Berg, dem abzulesen ist, daß sich hier eine
ungeheure Flutwelle Bahn gebrochen haben muß. Unmittelbar
an der Durchbruchsstelle liegt La Paz, in deren weiterer Umgebung sich
riesenhafte Schlammgebirge türmen. Der Beschauer gewinnt den
Eindruck, als steckten die alten Granitkerne der Kordillere in einer
Manchette aus weißem, grauen und rotem, mit Kiesellagern
untermischtem Ton. Dem Augenschein nach muß dazumal ein
ganzes Städtchen (Hanko-Hanko) auf einer kilometerdicken, vom
oberen Rande der La Paz-Schlucht losbrechenden Erdscholle in die Tiefe
verfrachtet sein, wobei die Hauptmasse der Flutwoge über die
Bewohner hinweggesprungen ist. Die kaum faßbare Wucht
dieser Flutwelle mögen die Lehm- und Schuttmassen beiderseits vom
Illimani, einem festen Rammsporn aus Granit, eindeutig illustrieren.
Für uns besteht kein
Zweifel darüber, daß die Mondeinfangsflut bei ihrem ersten
Brandungssturm auch bis zur Meseta hinauf leckte, im übrigen aber
Beben die Sperren der hochgelegenen Andenseen urplötzlich
sprengten. Einmal suchten die niederbrausenden Wasser einen Weg
ins heutige Argentinien hinein und zum andern dürften sie auch
westwärts in Richtung der heutigen Salpeterfelder Chiles zum
Stillen Ozean abgeflossen sein.
Abgesehen vom
erdgeschichtlichen Befund, der die Schreckenstragödie anschaulich
genug demonstriert, darf an einen weiteren sehr bezeichnenden Umstand
erinnert werden. Es ist bekannt, daß der Mensch in seinen
religiösen und magischen Kultzeichen Gegenstände oder lebende
Wesen darstellt, die er irgendwie mit seinem Eigenschicksal in
Verbindung bringt und die er durch entsprechende Nachbildungen
gleichsam bezwingen möchte. So finden sich unter den
Schätzen des Museums in La Paz außerordentlich viele
Darstellungen des Mondes in Verbindung mit dem Puma als
Verkörperung des Bösen. Demnach legten die Menschen
Alttihuanakus besonderes Gewicht auf den Mond, den sie irgendwie
fürchteten. Sie kannten diesen aber nicht als solchen,
sondern offenbar nur als Planeten, denn sie haben stets einen
kreisrunden Himmelskörper, ein typisches Planetenscheibchen,
nachgebildet. Den Mond auch einmal als Sichel darzustellen, kam
ihnen gar nicht in den Sinn und konnte es auch nicht, da sie am Ende
einer mondlosen Zeit, als "Vormondliche" lebten.
Halten wir im Sagenschatz der
Menschheit Umschau, so dämmert bei manchen Volksstämmen auch
die Mondeinfangskatastrophe nach. So konnte eine Mayainschrift
entziffert werden, die einen Atlantisuntergang berührt und einen
die Erde streifenden Planeten (!) dafür verantwortlich
macht. Die Chibchas im äquatorialen Südamerika
führen die Legende von einem Gott Nemquetscheba, der ein recht
böses Weib besaß. In einem Zornesausbruch ließ
das Weib, Huythaca, den Rio Funza (vom Meer her) so
(zurück-)schwellen, daß er die Hochebene von Cundinamarca
überschwemmte, und sich nur wenige Menschen im letzten Augenblick
auf die Berggipfel retten konnten. Um diese Untat zu rächen,
schleuderte der sonst menschenfreundliche Gott sein Weib zum Himmel, wo
es sich in einen Mond verwandelte. Von diesem Tage an soll eine
vordem mondlose Erde einen Mond besitzen.
Im Bemühen um
Ergründung des Zeitpunktes, da Alttihuanakus letzte
Kulturblüte ausgelöscht wurde, sind mehrere Forscher
unabhängig voneinander und auf verschiedenen Wegen zu dem Ergebnis
gelangt, daß beiläufig 14 000 Jahre verflossen sind, seit
die Menschheit einer ins Riesenhafte anwachsenden Wasserverlagerung
ausgesetzt war. Das deckt sich wiederum mit Berechnungen
derjenigen, die die Mondwerdung eines Planeten ähnlich datieren
und damit einen kosmisch verursachten Aufruhr auf Erden
verbinden. Deren Deutung läßt uns jedenfalls eine
bisher geheimnisvoll umschleierte, mit glänzenden Kulturen
ausgestattete wirkliche Vorgeschichte der Menschheit verstehen und
bietet den Vorzeitforschern den Schlüssel zur Klärung vieler
Probleme an, die bis dahin das Vorzeitgeschehen umwittern.
H.W. Behm
(Quelle: Buch "Die Sintflut und ihre Wiederkehr" von H.W. Behm, Jahrg. 1956, Sponholtz Verlag)